EFSA@EXPO im Rückblick: neu auftretende Probleme im Bereich der Tier- und Pflanzengesundheit
Das Risiko neu auftretender Schädlinge und Krankheitserreger hat sich infolge globaler Änderungen der Art Untergliederung der Gattung, eine Gruppe eng verwandter und ähnlicher aussehender Organismen; z.B. steht im Falle des Homo sapiens (Mensch) der zweite Teil des Namens (sapiens) für die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert und konsumiert werden, erhöht. Darüber hinaus dürfte die Verfügbarkeit von Lebensmitteln durch den Klimawandel zunehmend unter Druck geraten. Dieser schafft zudem neue günstige Bedingungen für invasive Arten, Schädlinge und Krankheitserreger. Durch wirtschaftliche, politische und humanitäre Krisen bedingte Bevölkerungsbewegungen sind eine weitere potenzielle Ursache für neu auftretende Probleme. Die Sektion befasste sich mit kulturellen und methodischen Veränderungen, die nötig sind, um neu auftretende Risiken anzugehen.
Menschen, Tiere, Pflanzen, Schädlinge und Erreger: eine Frage der Beziehungen
William Karesh von der EcoHealth Alliance in den Vereinigten Staaten eröffnete die Sektion mit einer Präsentation, deren Alternativtitel, ihm zufolge, hätte lauten können: “You get what you eat” (Man bekommt, was man isst). Neu auftretende Infektionskrankheiten sind auf dem Vormarsch – aber was sind die Ursachen? Mit dieser Frage steckte Dr. Karesh den Rahmen der Sektion ab. Und die Antwort? Karesh nannte drei Hauptfaktoren: Landnutzungsänderungen, Änderungen der landwirtschaftlichen Praxis sowie ein boomender internationaler Reiseverkehr und Handel. Er illustrierte seine These mit Hotspot-Karten und legte beispielsweise dar, wie die Palmöl-Nachfrage zu einer weit verbreiteten Abholzung geführt hat.

Beziehungen zwischen Erregern, Wirten und Umwelt: Verbindung der Punkte
Matthew Baylis von der Universität Liverpool erklärte, inwiefern das Konzept eines „ Pathogen Organismus (z.B. Bakterium, Virus oder Parasit), der eine Krankheit verursachen kann (Erreger)-Netzwerks“ für das Verständnis von Zoonosen von zentraler Bedeutung ist. Dabei ging er der Frage nach, auf welche Weise Krankheitserreger übertragen werden. Wirte können zusammenleben, eng verwandt sein oder sich voneinander ernähren. Die Hauptübertragungswege sind Umwelt, sexuelle Aktivität und Nahrungsaufnahme. In Anlehnung an William Karesh führte Baylis aus, dass um Zoonose Bezeichnung für Krankheiten und Infektionen, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können-Muster zu verstehen, wir zunächst die Ursachen von Tierkrankheiten wie Maul- und Klauenseuche, Geflügelpest und Afrikanischer Schweinepest ermitteln müssen.

Entdeckung neuer Übertragungswege von Erregern über Artengrenzen hinweg
Früher machte Natur mal Spaß, so Tony Goldberg von der University of Wisconsin-Madison, doch dann änderte sich die Geschichte, und die Natur wurde weniger als magischer Ort, sondern als Hort von Mikroben angesehen. Dies veranlasste ihn dazu, Primaten in einem Hotspot der Artenvielfalt in Uganda zu studieren, wo Primaten – zum Teil aufgrund von Infektionskrankheiten – vom Aussterben bedroht sind. Prof. Goldberg begab sich auf die „Virus-Jagd“, wobei er einige spannende aber beunruhigende Entdeckungen machte. Er führte aus, dass bei dem Versuch herauszufinden, welche Viren die Artengrenze überspringen werden, die beste Vorgehensweise die „Pfadentdeckung“ sei – also die Suche nach bislang unbekannten Übertragungswegen von Erregern. „Jenseits vom Buschfleisch“ müssen wir auch andere Formen der Interaktion zwischen Menschen und Primaten betrachten – wie etwa zufällige Kontakte, agressive Einzelgänger und Tiere, die von Hunden oder Kindern getötet werden.

Ursachen von Viehseuchen, Wirtschaft und Erregerentwicklung – eine Grobanalyse
Der unabhängige Berater Jan Slingenbergh wies zu Beginn seiner Ausführungen darauf hin, dass Nutztiererreger ein relativ neues Phänomen sind – das es seit etwa 12.000 Jahren gibt. Er stellte die Zunahme der Nachfrage nach tierischem Eiweiß dar und hob dabei zwei Spitzen hervor – die industrielle Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts und die „Vieh-Revolution“ der 1990er Jahre, die weltweit durch ein schnelles Wachstum der Produktion von tierischem Eiweiß geprägt war, was mit Massentierhaltung in „Monokulturen“ einherging. Wenn unser Anspruch darin besteht, für eine nachhaltige Tierproduktion zu sorgen, so seine abschließende These, dann müssen wir überdenken, welche Art von Lebensmitteln wir wirklich wollen und wie wir diese produzieren.
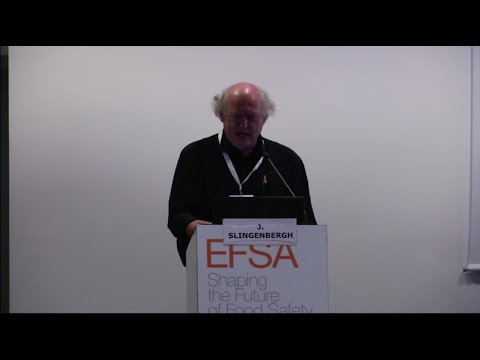
Früherkennung neu auftretender Viren im Bereich der öffentlichen und Tiergesundheit
Bei der systematischen Vorausschau („Horizon Scanning“) geht es darum, „die richtigen Experten zusammen und miteinander in Gespräch zu bringen“, so Paul Gale von der britischen Agentur für Tier- und Pflanzengesundheit. Neu auftretende Probleme zu entdecken gestaltet sich zunehmend schwieriger, weil die Welt sich verändert und die Viren mit ihr. Denken wir zum Beispiel an das Schmallenberg-Virus, das vor seiner „Ankunft“ im Jahr 2011 nicht einmal in Lehrbüchern erwähnt wurde. Hat man hier etwa schwache Signale übersehen, so die Frage Dr. Gales. Er erläuterte, dass es neben dem Verständnis der Ursachen und Pfade auch wichtig ist zu versuchen, Ereignisse miteinander in Beziehung zu setzen. Was verbindet beispielsweise den Einsatz eines entzündungshemmenden Arzneimittels bei Rindern mit einem Anstieg der Tollwutfälle in Italien? Oder den Bau von Swimming-Pools in Kalifornien mit der Finanzkrise und dem West-Nil-Virus? Dr. Gales empfahl die häufigere Verwendung von Concept-Maps, um Faktoren wie Landnutzung, landwirtschaftliche Praxis und sozioökonomischen Wandel zusammenzubringen und kommende zoonotische Ereignisse vorhersagen zu helfen.

Vision einer globalen Einsatzzentrale
Mike Catchpole vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten sprach eine deutliche Warnung aus: Die Realität ist, dass – unabhängig von unserem Wissensstand – wir virale Ereignisse und Ausbrüche nicht immer aufhalten können. Betrachten wir etwa das Beispiel der Influenza – wir wissen, dass es zu Ausbrüchen kommen wird; doch trotz bester Absichten können wir sie nicht verhindern. Es stellt sich also die Frage: Wie reagieren wir? Infektionskrankheiten sind ein globales Problem, weshalb die Reaktion darauf ebenfalls global sein muss, so Catchpole, der sich für eine globale Einsatzzentrale aussprach. Eine solche Zentrale müsste international und multidisziplinär sein und über effektive Kommunikations- und Koordinationsfunktionen verfügen. Dies würde ein klares, anerkanntes Mandat erfordern – und die Beteiligung der Weltgesundheitsorganisation wäre für die Bildung von Vertrauen von entscheidender Bedeutung.

Moderated Panel Discussion

Kontakt
Pressezentrum der EFSA
Tel. +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu
(Nur wenn Sie ein Mitglied der Presse sind)
Ask a Question-Service
Sie haben eine Frage zur Arbeit der EFSA? Wenden Sie sich an unseren Ask a Question-Service!