Genetisch veränderte Tiere
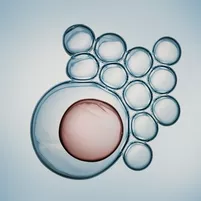
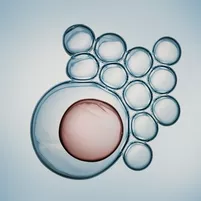
Bei einem genetisch veränderten Tier handelt es sich um ein Tier, dessen genetisches Material durch Hinzufügen, Verändern oder Entfernen bestimmter DNA Komplexes, kettenähnliches Molekül, das in allen Lebewesen und einigen Viren vorkommt und die genetischen Informationen (Gene) trägt. Die DNA (dt.: Desoxyribonukleinsäure – DNS) ist in der Lage, sich selbst zu kopieren, und enthält die „Baupläne“ aller Proteine, die für die Schaffung und Erhaltung von Leben notwendig sind-Sequenzen verändert wurde.
Es können verschiedene genomische Verfahren eingesetzt werden, um bestehende Merkmale eines Tieres zu verstärken oder zu hemmen. Sie können zudem verwendet werden, um neue Merkmale von Interesse, wie etwa Krankheitsresistenz, schnelleres Wachstum oder erhöhte Produktionskapazitäten für Lebensmittel, zu entwickeln.
Die DNA ist das Erbmaterial eines Organismus Lebewesen wie Menschen, Tiere, Pflanzen und Mikroben (z.B. Bakterien und Viren) und trägt die Anweisungen für alle Eigenschaften, die ein Organismus geerbt hat.
Veränderungen an den genetischen Anlagen eines Tieres können daher potenziell an die nächste Generation weitergegeben werden.
In der Lebensmittelproduktion wurde die Gentechnik bisher vor allem bei Pflanzen für die Landwirtschaft und bei Mikroorganismen zur Herstellung von Enzymen eingesetzt.
Die Forscher untersuchen jedoch auch den möglichen Einsatz von Techniken der genetischen Veränderung bei Tieren, die für Lebensmittel, Futtermittel oder andere Produkte wie Arzneimittel oder Organe für menschliche Transplantationen gezüchtet werden.
Nach den EU-Vorschriften müssen Risiken von gentechnisch veränderten Tieren oder hieraus gewonnenen Lebens- oder Futtermitteln bewertet werden, bevor sie in der EU in Verkehr gebracht werden dürfen.
Derzeit sind in der EU keine Lebens- und Futtermittel aus gentechnisch veränderten Tieren zum Verkauf zugelassen, und es sind noch keine entsprechenden Anträge eingegangen.
Ein genetisch veränderter Lachs ist für den Verzehr in den USA, Kanada und Brasilien zugelassen. Der AquAdvantage-Lachs wurde gentechnisch so verändert, dass er schneller wächst als sein nicht gentechnisch verändertes Gegenstück, der Atlantische Lachs.
Siehe auch:
Aktuelles
Wir führen eine öffentliche Konsultation zu unserem Entwurf eines wissenschaftlichen Gutachtens über neue Entwicklungen in der Biotechnologie (einschließlich synthetischer Biologie und neuer genomischer Verfahren) durch, die in der Viehzucht, bei Futtermitteln und anderen landwirtschaftliche Anwendungen angewendet werden.
Der Entwurf des Gutachtens untersucht die Anwendbarkeit und Angemessenheit der Risikobewertungsleitlinien der EFSA und umfasst Aspekte wie molekulare Charakterisierung, Lebens- und Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz sowie Umweltsicherheit. Die Konsultation läuft bis zum 19. März 2025.
Meilensteine
2023
Die EFSA veröffentlicht eine Bewertung der kommerziellen und vorkommerziellen Anwendungen neuer genomischer Verfahren (NGT), die auf Nutztiere und daraus gewonnene Lebens- und Futtermittelerzeugnisse angewandt werden.
2017
Die EFSA veröffentlicht eine Bewertung der potenziellen Integration des Plasmid-DNA-Impfstoffs CLYNAV in das Lachsgenom.
2013
Die EFSA veröffentlicht Leitlinien für die Umweltverträglichkeitsprüfung Bewertung des potenziellen Schadens für die Umwelt durch einen Stoff, eine Aktivität oder ein natürliches Ereignis. Dies kann sich auf die Einführung genetisch veränderter Pflanzen, den Einsatz von Pestiziden oder die Ausbreitung von Pflanzenschädlingen beziehen von genetisch veränderten Tieren.
2012
Die EFSA veröffentlicht Leitlinien für die Risikobewertung Spezialgebiet der angewandten Wissenschaften, in dem wissenschaftliche Daten und Studien ausgewertet werden, um die mit bestimmten Gefahren einhergehenden Risiken zu beurteilen. Dies umfasst vier Schritte: Gefahrenidentifizierung, Gefahrencharakterisierung, Expositionsabschätzung und Risikocharakterisierung von Lebens- und Futtermitteln, die aus GV-Tieren gewonnen werden, unter Einbeziehung von Aspekten der Tiergesundheit und des Tierschutzes.
Rolle der EFSA
Die EFSA bewertet mögliche Risiken aufgrund von genetisch veränderten Organismen ( GVO Ein genetisch veränderter Organismus (GVO) ist ein Organismus, der genetisches Material enthält, welches absichtlich verändert wurde und das durch Züchtung oder Selektion nicht natürlicherweise vorkommt) für die menschliche sowie die Tiergesundheit und die Umwelt.
Bei genetisch veränderten (GV-) Tieren sind unsere Wissenschaftler auch für die Bewertung von Aspekten der Tiergesundheit und des Tierschutzes zuständig.
Die Aufgabe der EFSA besteht darin, der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten wissenschaftliche Beratung zur Sicherheit von GVO bereitzustellen. Diese sind für die Zulassung von GVO und die Bedingungen für ihre Verwendung auf dem europäischen Markt zuständig.
Bei der Bewertung der Sicherheit von GVO, bevor diese zur Verwendung als Lebens- oder Futtermittel in der EU zugelassen werden können, wendet die EFSA die im EU-Rechtsrahmen Bezeichnung für Richtlinien und Gesetze in Europa, die in ihrer Gesamtheit den Verbraucher schützen sollen festgelegten Kriterien an.
Unsere wissenschaftliche Beratung hilft den politischen Entscheidungsträgern, über die Regulierung neuer Produkte zu entscheiden, die sich aus den Fortschritten in der Biotechnologie ergeben.
Ethische Erwägungen sind nicht Teil des wissenschaftlichen Prozesses der Risikobewertung. Diese Aspekte werden von der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Beratungen über neue Verordnungen und ihre Genehmigungsverfahren für neue Produkte berücksichtigt.
Unsere Wissenschaftler bewerten auch, ob unsere Leitlinien für die Sicherheitsbewertung neuer Anwendungen der Biotechnologie geeignet sind.
Wir haben neue Leitlinien für die Risikobewertung von GV-Tieren sowie von aus GV-Tieren gewonnenen Lebens- und Futtermitteln für den Fall entwickelt, dass wir Anträge für Risikobewertungen erhalten.
EU-Rechtsrahmen
Die Europäische Union verfügt über einen Rechtsrahmen für den Einsatz der Technologie für Genveränderungen, um ein hohes Maß an Schutz für die Gesundheit des Menschen und die Tiergesundheit sowie die Umwelt zu gewährleisten.
In diesem Rahmen sind die Herstellung von GVO-Lebens- und Futtermitteln, Einfuhren von GVO sowie die Freisetzung von GVO in die Umwelt streng geregelt.
GV-Tiere sowie aus GV-Tieren gewonnene Lebens- und Futtermittel müssen einer Sicherheitsbewertung durch die EFSA unterzogen werden, bevor sie in der EU zugelassen werden können.
- Genetisch veränderte Organismen – Europäische Kommission
- Übersicht über alle Vorschriften und Leitlinien
FAQ
Die Leitlinien beschreiben einen Risikobewertungsansatz für den Vergleich von GV-Tieren und aus diesen gewonnenen Lebens- und Futtermitteln mit ihren jeweiligen konventionellen Gegenstücken. Die Grundannahme dieser Art Untergliederung der Gattung, eine Gruppe eng verwandter und ähnlicher aussehender Organismen; z.B. steht im Falle des Homo sapiens (Mensch) der zweite Teil des Namens (sapiens) für die Art von vergleichender Bewertung ist, dass Lebens- und Futtermittel von konventionell gezüchteten Tieren in der Vergangenheit sicher verwendet wurden und daher als Grundlage für die Risikobewertung von Lebens- und Futtermitteln dienen können, die von GV-Tieren stammen. Wichtige Bestandteile der Risikobewertung sind die molekulare Charakterisierung, die Analyse der Zusammensetzung und die Bewertung der Toxizität Potenzial eines Stoffs, einem lebenden Organismus zu schaden, der ernährungsphysiologischen Aspekte und der potenziellen Allergenität Fähigkeit, eine nicht normale Immunreaktion hervorzurufen, die bei einem Menschen zu einer allergischen Reaktion führt. So werden Sachverständige beispielsweise bewerten, ob aus GV-Tieren gewonnene Lebens- und Futtermittel für Menschen und Tiere genauso nahrhaft sind wie die von konventionell gezüchteten Tieren.
In den Leitlinien wird auch die Methodik beschrieben, die für die vergleichende Bewertung Gesetzlich vorgeschriebene Bewertung zum Vergleich der Sicherheit eines genetisch veränderten Organismus mit der seines nicht genetisch veränderten Pendants der Aspekte der Gesundheit und des Wohlbefindens von genetisch veränderten Tieren benötigt wird. Diese Bewertung erfolgt auf zweierlei Weise: erstens in Bezug auf das GV-Tier selbst, bei dem sich die Bewertung auf das wirksame Funktionieren der Körpersysteme der Tiere konzentrieren sollte (z. B. Krankheitsresistenz), und zweitens in Bezug auf die Risikobewertung von Lebens- und Futtermitteln, da die Tiergesundheit und der Tierschutz als wichtige Indikatoren für die Sicherheit tierischer Erzeugnisse angesehen werden.
Die Leitlinien enthalten zudem Empfehlungen für die fallweise Überwachung nach dem Inverkehrbringen von Lebens- und Futtermitteln, die von gentechnisch veränderten Tieren stammen.
Die EFSA kam zu dem Schluss, dass eine Risikobewertung für genetisch veränderte Tiere drei wichtige Aspekte umfassen sollte. Zunächst sollte ein sechsstufiges Bewertungsverfahren durchgeführt werden. Dieser schrittweise Prozess, der in den EU-Rechtsvorschriften festgelegt ist, sollte mit der Ermittlung potenzieller Gefahren und des Ausmaßes der Exposition Konzentration oder Menge eines bestimmten Stoffs, die von einem Menschen, einer Population oder einem Ökosystem mit einer bestimmten Häufigkeit über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufgenommen wird von Mensch, Tier und Umwelt gegenüber diesen Gefahren beginnen. Die nächsten drei Phasen bestimmen die Gefahr Stoff oder Aktivität, der/die das Potenzial besitzt, in Lebewesen oder Umgebungen schädliche Wirkungen hervorzurufen und die Exposition sowie – aus der Kombination der beiden – das potenzielle Risiko. Schließlich müssen die Antragsteller Risikomanagementstrategien umreißen und eine Gesamtrisikobewertung vorlegen.
Im zweiten Schritt sollten die Antragsteller Informationen zu sieben Bereiche vorlegen, in denen ein potenzielles Risiko für genetisch veränderte Fische, Insekten, Säugetiere oder Vögel besteht:
- Persistenz und Invasivität des GV-Tieres, einschließlich des vertikalen Gentransfers
- horizontaler Gentransfer
- Wechselwirkungen zwischen dem GV-Tier und Zielorganismen
- Wechselwirkungen zwischen dem GV-Tier und Nicht-Zielorganismen
- Umweltauswirkungen der spezifischen Verfahren, die für die Bewirtschaftung des GV-Tieres eingesetzt werden
Auswirkungen des GV-Tieres auf biogeochemische Prozesse - Auswirkungen des GV-Tieres auf die Gesundheit von Mensch und Tier
In den Leitlinien werden zudem bereichsübergreifende Erwägungen hervorgehoben, die in den gesamten Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung einfließen sollten. Dazu gehören, welche nicht genetisch veränderten Tiere als Vergleichstiere verwendet werden sollen, die Verwendung geeigneter Ersatztiere, falls dies für notwendig erachtet wird, sowie Empfehlungen für die Bewertung potenzieller Langzeitwirkungen von GV-Tieren sowie für die Unsicherheitsanalyse Methode zur Identifizierung von Quellen, Ausmaß und Richtung der Unsicherheit bei Berechnungen im Rahmen der Risikobewertung, sodass möglichen Fehlern Rechnung getragen werden kann.
Die EFSA erkennt an, dass Bedenken hinsichtlich der Tiergesundheit und des Tierschutzes im Zusammenhang mit der Entwicklung von GV-Tieren für Lebens- und Futtermittel bestehen. Die Anforderungen an die Bewertung der Tiergesundheit und des Tierschutzes sind in beiden Leitlinien zu genetisch veränderten Tieren integriert.
In den Leitlinien zu Lebens- und Futtermitteln, die aus GV-Tieren gewonnen werden, wird die Notwendigkeit umfassender vergleichender Analysen der Merkmale und Eigenschaften von GV-Tieren, einschließlich physiologischer Parameter, mit denen ihrer konventionellen Gegenstücke hervorgehoben. Sie schlägt außerdem vor, dass Gesundheit und Wohlergehen in allen Phasen der Entwicklung des gentechnisch veränderten Tieres bewertet werden sollten. Die empfohlene Bewertungsstrategie umfasst die Laborumgebung, in der das GV-Tier ursprünglich entwickelt wird, experimentelle Feldversuche außerhalb des Labors mit einer höheren Anzahl von Tieren und Versuche mit einer großen Zahl von Tieren, die (vor der Zulassung) in einem kommerziellen Umfeld durchgeführt werden.
Die Leitlinien für die Umweltverträglichkeitsprüfung gelten auch für GV-Tiere, die nicht als Lebensmittel/Futtermittel verwendet werden, wie z. B. Zierfische. In diesen Fällen stellt das Dokument Leitlinien zu den Datenanforderungen zur Verfügung und umreißt die Verpflichtung der Antragsteller, nachzuweisen, dass die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere im Vergleich zu einem geeigneten Vergleichstier – einem nicht genetisch veränderten Gegenstück, das als Ausgangsbasis für die Bewertung des genetisch veränderten Tieres herangezogen wird – nicht erheblich beeinträchtigt sind. Wo kein Vergleichstier identifiziert werden kann, sollten die Gesundheit und das Wohlergehen des genetisch veränderten Tieres selbst betrachtet werden. Wenn Experimente durchgeführt werden müssen, um Daten zu generieren, sollten diese im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften über die Verwendung von Tieren für wissenschaftliche Zwecke stehen.
Die Überwachung und Beobachtung nach dem Inverkehrbringen werden ebenfalls als notwendig erachtet, um unbeabsichtigte Auswirkungen der genetischen Veränderung auf die Gesundheit und das Wohlergehen des GV-Tieres festzustellen, die nach der Genehmigung des Inverkehrbringens auftreten.
Bei der genetischen Veränderung wird das genetische Material eines Tieres modifiziert. Das Klonen von Tieren Technik, die angewendet wird, um eine exakte genetische Kopie eines Tieres zu erstellen. führt zur Schaffung eines Tieres, bei dem es sich um eine genetisch identische Kopie des Originals handelt.